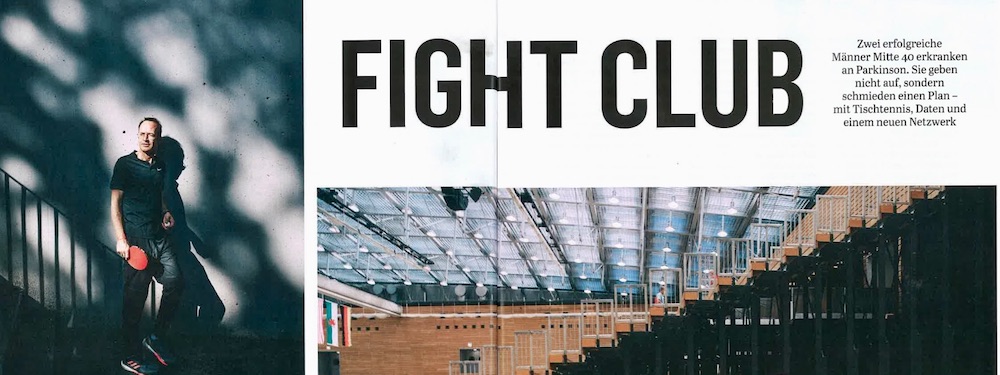Früher erschöpfte sich die Therapie in reiner Pflege. Der fortschreitende Untergang von Nervenzellen und der damit einhergehende Mangel des wichtigen Botenstoffes Dopamin im Gehirn schränkte Parkinson-Patienten zunehmend in ihrer Mobilität ein, ohne daß in diesen unaufhaltsamen Prozeß wirksam eingegriffen werden konnte. Wenngleich der Alltag der betroffenen Menschen auch heute noch mit zunehmendem Verlauf ihrer Erkrankung durch die charakteristische Steifigkeit der Gelenke und das auffällige Zittern in vielfältiger Weise beeinträchtigt ist, hat die Behandlung in den 60er Jahren durch Medikamente, die den Dopamin-Mangel ausgleichen, einen großen Durchbruch erfahren. Darüber hinaus stehen neuerdings zusätzliche Präparate zur Verfügung, durch die das Fortschreiten des Zelluntergangs verlangsamt werden kann. Hinzugekommen ist in jüngster Zeit ein operatives Verfahren, bei dem eine von außen steuerbare winzige Sonde ins Gehirn implantiert wird, über die starkes Zittern weitgehend unterdrückt werden kann.
Unmittelbare Rückschlüsse auf das persönliche Befinden der Patienten sind aufgrund dieser Therapiefortschritte indes nicht ohne weiteres zu ziehen. Ob oder inwieweit medizinisch meßbare Kriterien einen Einfluß auf die Lebensqualität haben, können die Betroffenen am besten selber beurteilen. Die Einschätzung der Ärzte und die der Patienten könne weit auseinanderliegen, betont Dr. Klaus Berger vom Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin der Universität Münster. Seit Herbst letzten Jahres leitet der Neurologe und Neuroepidemiologe die erste wissenschaftliche Studie zur Lebensqualität von Parkinson-Kranken, wobei er Lebensqualität als selbstempfundenen Gesundheitszustand definiert. Speziell soll die an den Parkinson-Ambulanzen von zehn deutschen Uni-Kliniken durchgeführte Untersuchung Aufschluß darüber geben, durch welche Faktoren die Lebensqualität aus Sicht der Betroffenen beeinflußt wird. Solche Ergebnisse könnten nicht nur eine wichtige Grundlage für eine bestmögliche Beratung und Behandlung künftiger Patienten sein. Vielmehr könnten sie auch von gesundheitspolitischer Relevanz sein, indem sie handfeste Daten liefern, mit denen vor dem Hintergrund des derzeitgen Sparkurses die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen, wie etwa Physiotherapie, untermauert werden kann.
Da das Auftreten der Symptome und das Wohlbefinden der Patienten im Laufe ihrer Erkrankung häufig schwankt, soll die Studie nicht nur eine Momentaufnahme bringen. Um ein zuverlässigeres Bild zu bekommen, werden die Teilnehmer vielmehr nach der Ersthebung noch einmal nach Ablauf eines halben Jahres und dann noch einmal nach einem weiteren halben Jahr befragt. Diese Datenerhebung erfolgt mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogens, den die bundesweit 210 Studienteilnehmer im Alter zwischen 41 und 84 Jahren in den Wartezimmern der Ambulanzen ausfüllen. Um diese Selbsteinschätzung in Korrelation zu medizinischen Befunden, zur Inanspruchnahme ambulanter Dienste und zu möglichen Belastungen der Familie setzen zu können, erhalten behandelnde Ärzte und Angehörige der Patienten ebenfalls einen speziell auf sie zugeschnittenen Fragebogen.
Ziel der Untersuchung ist es, den Einfluß krankheitsspezifischer Faktoren wie Zittern oder Steifigkeit, die mögliche Auswirkung ambulanter Dienste wie etwa Essen auf Rädern, Krankengymnastik oder Selbsthilfegruppe, das Vorliegen weiterer Erkrankungen sowie den Einfluß der Medikation auf die Lebensqualität von Parkinson-Kranken zu eruieren. So geht Berger beispielsweise davon aus, daß Patienten, bei denen das Zittern als Symptom ihrer Erkrankung im Vordergrund steht, krankheitsspezifischen Faktoren deutlich größere Bedeutung zumessen als Kranken, die in erster Linie an Gelenksteifigkeit leiden. Da das Zittern in vielen Alltagssituationen, wie etwa beim Essen oder beim Unterschreiben, augenfällig wird, geht Berger davon aus, daß diese Patienten größere psycho-sozialen Probleme haben und sich eher stigmatisiert fühlen.
Bei der Untersuchung des Einflusses der Medikation geht es dem Studienleiter darum, vor dem Hintergrund der heute üblichen Kombinationsbehandlung mit mehreren Präparaten herauszufinden, ob beispielsweise eine Zweier- oder Viererkombination von Medikamenten im selbstempfundenden Gesundheitszustand Unterschiede bedingt. Besonders große Bedeutung wird dem Einfluß ambulanter Dienste beigemessen. Sollte sich etwa zeigen, daß ein Patient mit objektiv schwerer Symptomatik, der bestimmte ambulante Dienste nutzt, ein höheres Maß an Lebensqualität empfindet als ein Kranker mit leichter Symptomatik, der auf diese Hilfen verzichtet, so könnte dies laut Berger von Relevanz für das weitere Vorgehen bei der Versorgung von Parkinson-Kranken sein.
Trotz aller Fortschritte bei der unmittelbaren medizinischen Behandlung und des durch die Studie deutlich werdenden verstärkten Augenmerks auf die Lebensqualität, ist die Diagnose einer Parkinson-Erkrankung freilich nach wie vor ein tiefer Einschnitt in das bisherige Leben. Drei bis vier Prozent aller Menschen jenseits des 70. Lebensjahres sind von diesem neurodegenerativen Leiden betroffen. Durch verstärkte Früherkennung nehmen die Zahlen zu, und vermehrt trifft die Diagnose auch jüngere Menschen. Im Rahmen der bundesweiten Selbsthilfevereinigung gibt es laut Berger heute bereits sogenannte U-40-Clubs, in denen sich unter 40jährige Patienten zusammengeschlossen haben.
Auch vor diesem Hintergrund wird die von der Wilhelm-Woort-Stiftung für Alternsforschung und einem Pharmakonzern geförderte Studie zur Lebensqualität große Bedeutung beigemessen. So hat Dr. Klaus Berger bereits vor der abschließenden Auswertung der Untersuchung, deren Ergebnisse im Sommer nächsten Jahres vorliegen sollen, vor kurzem den erstmals vergebenen Forschungspreis der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinson-Forschung erhalten.